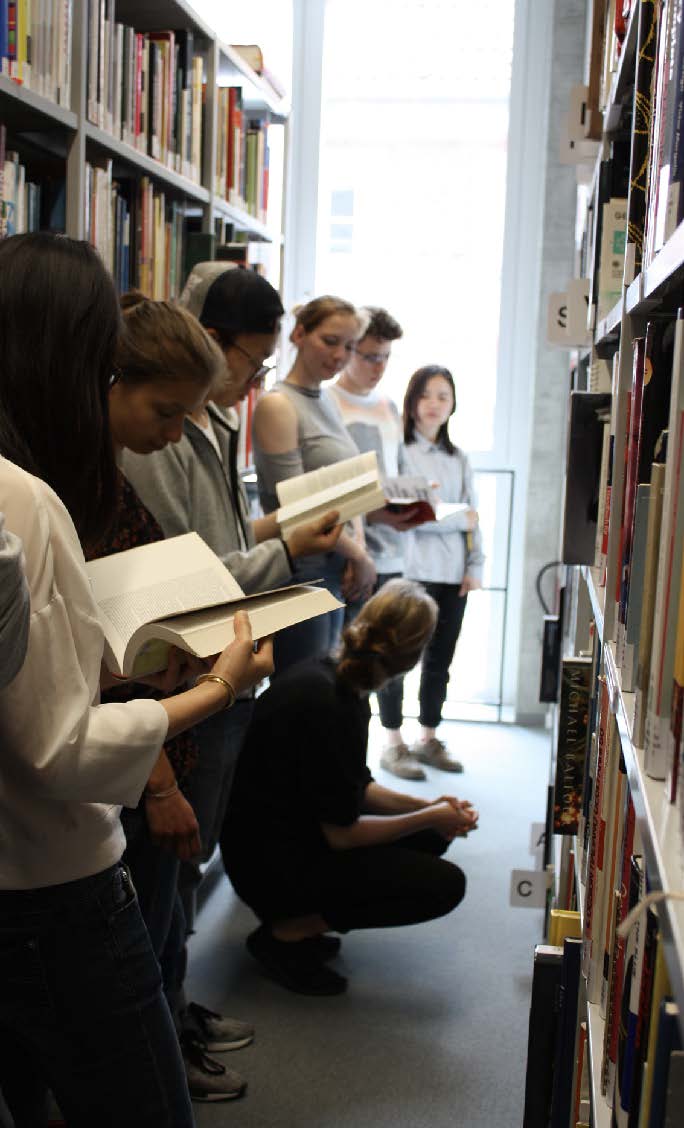
Was ist Designwissenschaft? Diese Frage lässt sich – insbesondere mit Blick auf die verschiedenen Diskurse über das Verhältnis von Theorie und Praxis im Design – nur schwer beantworten. Bei näherer Betrachtung des Feldes fällt zunächst auf, dass die Designtheorie ebenso divers ist wie das Design insgesamt. Derzeit können innerhalb der Designtheorie jedoch vor allem zwei Richtungen ausgemacht werden: Neben einer angewandten Designforschung, die aus den Entwurfsprozessen selbst die Methoden und Begriffe des Designs entwickelt, gibt es einen kulturwissenschaftlichen resp. genuin designwissenschaftlichen Zugang zum Design, der es ermöglicht, historische und gegenwärtige Designdiskurse ebenso wie angewandte Designforschung mit Blick auf die ihnen inhärenten Ideen und Bezüge zu diskutieren. Dieser Ansatz geht davon aus, dass es die Objekte des Designs sind – also die Produkte, Prozesse, Interaktionsweisen und Systeme – die von sich aus schon bestimmte (historische und gegenwärtige) Vorannahmen beinhalten und damit auch Ausdruck von Theorien sind. 
Dies setzt ein bestimmtes Verständnis von Design als Prozess voraus: alles Design steht – in prozesshafter Sichtweise – immer schon in einem bestimmten Kontext aus Materialien, Techniken, Diskursen, Theorien, Akteuren und bisherigem Design. Es handelt sich um ein komplexes Gefüge aus Praxisformen und Ideen. Anders gesagt: Theorien im Design können nicht losgelöst von Praxis verstanden werden und umgekehrt. Designpraxis wird zum diskursiven Element, wobei die Objekte des Designs allerdings ihre Theorien nicht explizit artikulieren, weil diese erst durch Kenntnis des Zusammenhangs sichtbar werden, während die Zusammenhänge in der Wissenschaft durch Referenzen kenntlich gemacht werden. Die Produkte des Designs sind Objekte, Systeme und Zeichen; Produkte der Wissenschaft sind in erster Linie Texte. Wissenschaft und Design existieren also in unterschiedlichen Formaten, aber nicht getrennt voneinander. Ein Verständnis dieses komplexen Gefüges zu entwickeln ist Ziel der praxisnahen Vermittlung von Designwissenschaft und -forschung an der Muthesius Kunsthochschule Kiel. Im Zentrum der Diskussion stehen dabei stets gestalterische Projekte. Dies sind einerseits die Arbeiten der Studierenden, die auf ihre methodischen und theoretischen Implikationen hin befragt werden, um ein reflektiertes Verständnis des eigenen Tuns zu entwickeln. Zudem werden auch Präsentationsformate und Formen des Ausstellens diskutiert. Dies können aber auch historische Beispiele für Designprozesse sein oder aber übergreifende Diskurse wie zum Beispiel der Diskurs um praxisbasierte Designforschung – der ebenfalls als eine Art »Projekt« verstanden werden kann. Wir verbinden dabei klassische Lehrformate wie die des Lektüreseminars, in dem kanonische und aktuelle Texte gelesen werden, mit Methoden der angewandten Designforschung. Neben der Lektüre werden eigene Texte produziert. Im Zentrum des Schreibprozesses steht hier der Entwurf eines Textes, Schreiben wird in diesem Sinne als eine Praxisform mit teilweise handwerklichen Implikationen verstanden, sodass das gestalterische Vermögen der Studierenden auf der Ebene des Textes zum Ausdruck gebracht werden kann.